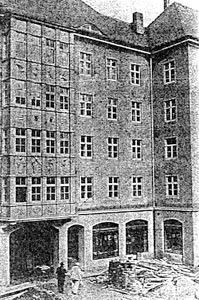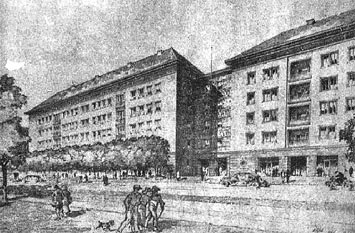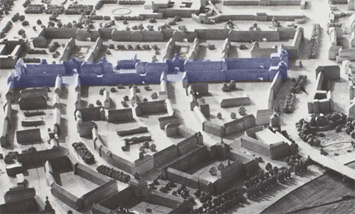|
| Architekt: |
|
Bernhard
Klemm & Kollektiv, W. Hänsch
Planungsgrundlagen 1949- 50: Oberbaurat
Kurt W. Leucht + Gartenarchitekt
Hans Bronder
Berufsschulzentrum: Gottfried Klingner (VEB Projektierung - Sachsen)
+ Walter Henn (TH) |
| Bauzeit: |
|
1951-55
(polytechn. Oberschule 1959-60) |
| Adresse:
|
|
ehemalige
Pirnaische Vorstadt:
Grunaerstraße, Zirkus-, Mathilden-, Seidnitzer-, Blochmannstraße |
| Denkmal-schutz: |
|
seit 1990 |
Die
"Wohnzelle" Grunaer Straße, ein völlig neues
Stadt-quartier, ist städtebaulich einerseits nach den Grundsätzen
der aufgelockerten, durchgrünten Stadt der Moderne entworfen.
Diese Grundprinzipien waren bereits in den späten 20er Jahren
durch die europäischen CIAM-Kongresse detailliert konzipiert
und in Deutschland auch in den neuen Wohnsiedlungen während der
30er Jahre angewendet worden. Vorläufer war die Reformbewegung
der "Gartenstadt" um 1900. Große weite grüne
Innenhöfe, Vorgärten und reichlich Straßengrün
sollten mitten in der Stadt für eine gesunde hygienische Atmosphäre
sorgen.
Andererseits spielten Überlegungen der kompakt- dichten,
urbanen europäischen Stadt eine Rolle. Die Stadtquartiere sollten
doch deutlich einen repräsentativen Großstadt-charakter
haben mit Betonung und Akzentuierung von Hauptplätzen und -straßen.
Dieser Spagat zwischen grünem "Gartenstadt"-Konzept und großstädtischer Zentrumsplanung kulminierte an diesem Pilotbauprojekt in der Pirnaischen Vorstadt. Kurt Leuchts Begriff vom Stadtlandschaftsraum kommt hier zum Tragen. Allerdings hieß es in den politischen Zielsetzungen auch:
"Die Stadt in einen Garten zu verwandeln, ist unmöglich. Selbstverständlich muß für ausreichende Begrünung gesorgt werden. Aber der Grundsatz ist nicht umzustoßen: in der Stadt lebt man städtischer; am Stadtrand oder außerhalb der Stadt lebt man ländlicher." (Zitat aus "16 Grundsätze des Städtebaus" von 1950)
 Bebauungsplan
Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang
der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.
Plan aus: Hans Bronder, Die Grünflächen beim Aufbau der Stadt
Dresden, in: Deutsche Gartenarchitektur, Zeitschrift, Ost-Berlin 1
(1960), S.3-12
Bebauungsplan
Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang
der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.
Plan aus: Hans Bronder, Die Grünflächen beim Aufbau der Stadt
Dresden, in: Deutsche Gartenarchitektur, Zeitschrift, Ost-Berlin 1
(1960), S.3-12
Das Komplexzentrum mit Gaststätte,
Läden und Handwerkereinrichtungen etc. (A) - ähnlich gestaltet wie die Webergasse -
wurde nicht umgesetzt.
Die erste "Wohnzelle" Dresdens nach 1945, konzipiert für
ca. 5000 Menschen, war jedoch kein Resultat einer spontanen Bebauung
irgendwo, sondern bildete einen organischen Teil einer umfassenden
Gesamtkonzeption für ganz Dresden bzw. den Grossraum Dresden
und die gesamte Region des Elbkessels von 1949/ 1950. Diese weitgreifende
Planung behandelte Dresden, trotz Gründung zweier getrennter
deutscher Staaten, immer noch als Hauptstadt eines Landes
Sachsen. Bereits 1952 jedoch wurden die Länder in der SBZ einer Verwaltungsreform unterzogen und in "Bezirke" unterteilt.
45% Grünanteil
Die Neuordnung der Dresdner Innenstadt nach
1945 stufte die
"Pirnaische Vorstadt" zugehörig zum "Zentralen Bezirk"
(heute ca. "26er" Ring) ein. Dieser wäre um das "Zentrum" gelagert und
sollte vorwiegend einer innerstädtische Bebauung aufweisen mit
ausreichend Grünanlagen. Eine städtische Architektur, von großzügigen
Grünräumen durchzogen mit Sonne, Frischluft, mit parkartigen
großen Wohnhöfen und
Spielplätzen, ohne Gewerbelärm und Schmutz! All
das ist hier fast schon in verschwenderischer Fülle umgesetzt worden -
mit 45% Grünanteil !
Architektur, an Traditionen anknüpfend und doch neue Wege
suchend
Die nach den Grundsätzen der hygienischen, neuen Stadt errichtete
Architektur der ersten Dresdner Wohnzelle wird in die sogenannte "Nationale
Tradition" eingestuft. Schräge, rotfarbene Ziegeldächer,
Akzentuierungen in Werkstein, Erker und ockerfarbener Putz sorgten
für Wiedererkennungseffekte im Vergleich zu Gebäuden vor
der Zäsur 1945. Angestrebt war eine moderate Ähnlichkeit
mit einer als dresdentypisch empfundenen Architektur, ohne die revolutionären
Veränderungen einer radikal neuen Gesellschaftsordnung der "Arbeiter-
und Bauernmacht" zu leugnen. Man könnte dieses ausbalancierte
Gleichgewicht zwischen Umbruch und Kontinuität durchaus als erfolgreich
beschreiben, wenn man den politisch-stalinistischen Terror dieser
Zeit ausblendet.
Diese ersten neuen Nachkriegsgebäude erinnern, wie Jan von Havranek
2001 in "das neue dresden 1919 - 1949" beschreibt, sehr
an die Neubauten in der Paul-Wolf-Ära Mitte der 1930er Jahre.
Im 1. Bauabschnitt einer groß angelegten Alstadtsanierung wurde
z.B. dieser Ersatzbau Marktstraße (ehemals Kleine und Große
Frohngasse, heute Weiße Gasse) 1935-38 vom Hochbauamt der Stadt
Dresden errichtet:
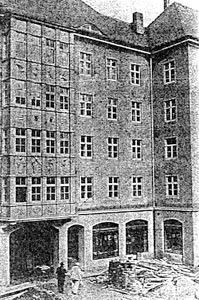
Foto: Adressbuch Dresden 1938 / Band 1, S.4
Auch der Städtebau knüpft an die Paul-Wolf-Zeit der 1930er Jahre an. Vergleicht man z.B. die angestrebte Wohndichte von 250 Einwohner je ha, so kommt diese Zahl sehr nah an die Planungen des Hochbauamtes unter Wolf heran. Z.B. sah man für das Wohnquartier südlich der Münchner Straße eine Dichte von 230 Ew/ ha vor. Schwarzplan 1935 (geplant 1931)
(Der nördliche Teil wurde leicht verändert realisiert, aus: Zentralblatt der Bauverwaltung Heft 2/1935, S.23)
Auch die Mischung von Blockrandbebauung und Zeilenbauten mit hohem Grünanteil ähnelt jener Zeit. Vgl. Luftbild heute
Bernhard Klemm's neue Wohnbauten oszillieren also zwischen Kontinuitätsbestreben, Traditionsbindung, verhaltener Sachlichkeit und maßvoller Moderne, die diesen Bauten auch den Vorwurf des "Formalismus" einbrachten.
Hermann Henselmann kritisierte z.B. in der Zeitschrift Deutsche Architektur 2/1952 die mangelnde "Pflege und Entwicklung der reichen Dresdner künstlerischen Traditionen."- der gesamte Text.
Der Architekturhistoriker Ralf Koch wies in seiner 1999 erschienenen Dissertation über den Wiederaufbau in Leipzig und Dresden 1945- 55 darauf hin, dass in Dresden ab 1948 Wiederaufbauplanungen aus der NS-Zeit in die Konzeption einflossen:
"Konzept der Stadtlandschaft mit strenger Zellenordnung, wie es seit Beginn der vierziger Jahre von Planern analog dem Gliederungsmuster der NSDAP zur Vorbereitung des Wiederaufbaus nach Kriegsende entwickelt worden war."
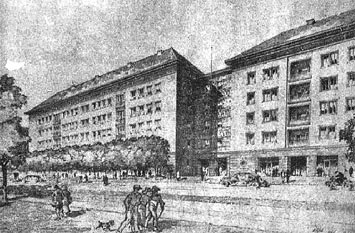
Grunaer Strasse, Entwurfszeichnung 1951, Foto: SLUB
Der Architekturführer Dresden 1997 beschreibt die Bauten der
Wohnzelle Grunaer Straße folgendermaßen:
Mit dem
"Gesetz über den Aufbau der Städte in der DDR und der
Hauptstadt Deutschlands, Berlin" und den "16 Grund-sätzen
des Städtebaus" wurden Maßnahmen zur Planung und Gestaltung
des Wohnungsbaues festgelegt. Im großflächig enttrümmerten
Gebiet der Pirnaischen Vorstadt wurde es möglich, eine in sich
geschlossene Siedlungszelle, die von Grünflächen durchzogen
ist, zu realisieren. Die fünfgeschossigen Häuser an der
Nordseite der Grunaer Straße, noch in traditioneller Bauweise
errichtet, stellen den Beginn des organisierten Neuaufbaus in Dresden
dar. Sandstein-Putz-Fassaden, Erker, Loggien und Torbögen sind
architektonische Elemente, in denen Dresdner Bautradition anklingen
soll. Das EG der Häuser Grunaer Str. 23-29 ist zur Ladenzone
ausgestaltet. Im Verlauf der 50er Jahre entstand im Karrée
Mathilden-, Zirkus-, Seidnitz-, Grunaer Straße eine Blockrandbebauung
mit Durchfahrtstraßen und Höfen. (aus: Architekturführer
Dresden, 1997)
Blockrandbebauung?
Die hier beschriebene "Blockrandbebauung" ist für das
Quartier der ersten Dresdner "Wohnzelle" eine irrtümliche
Bezeichnung. Eine sehr differenzierte Bebauung mit freistehenden Einzelblöcken
und ganz unterschiedlich breiten Abständen zur Straße mit zum Teil erheblichen Abstandsgrün läßt eher auf eine
interessante Mischung von alt-europäischem Städtebau und
neu-europäischen Stadtbaukonzepten des frühen 20. Jahrhunderts
schließen.
Zum Vergleich die Situation vor 1945 in einem "Schadensplan der Stadt Dresden", bearbeitet 1945/ 46. Gut zu erkennen im markierten Gebiet: ein Teil der zu enttrümmernden gründerzeitlich-dichten Häuserblöcke mit Hinterhofbebauung ist gelb markiert. Foto: SLUB Dresden

Keine Blockrandbebauung, sondern sehr viel Grünanteil bis zur Straße,
Foto: April 2023 Thomas Kantschew,
Vergrößerung
Städtebau: Verlängerung der Magistrale
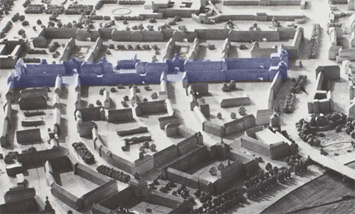
Stadtmodell: Herbert Schneider, ca. 1953,
Quelle: Deutsche Fotothek,
Vergrößerung (blau markiert: Grunaer Straße)
Auf dem Höhepunkt stalinistischer Stadtplanung ließ Stadtarchitekt
Herbert Schneider ein Stadtmodell bauen, welches gut demonstriert, wie
die Magistrale durch die Altstadt (Thälmannstraße) nach Osten und
Westen auf über 2,5 km
verlängert werden sollte. So wäre ein monumentaler Magistralenraum
entstanden vom "Fučíkplatz", über die Grunaer Straße, den Pirnaischen Platz,
Altmarkt, Postplatz bis zur Ammonstraße (Eisenbahn). Ähnlich der Stalinallee in
Ostberlin sollte eine eindrucksvoll politische
Demonstrations-achse Macht demonstrieren.
In dieser Planung von Herbert Schneider war die Grunaer Straße
ebenfalls eine herkömmliche
"Korridorstraße", aber als Ausfallstraße sollte sie durchaus
mit politischer Bedeutung
aufgeladen werden. Gegenüber dem leicht zurück
gesetzten Mittelteil war die Öffnung zu einem weiten,
blockumspannenden Innenhof vorgesehen, in dessen Mitte zentral ein
öffentliches Gebäude stehen sollte. Die beiden Einmündungen nach
Norden, Zirkusstraße und Mathildenstraße, sollten im
leichten Halbkreis Richtung Elbe schwingen. Nach Süden wären diese
beiden Straßen nicht weiter geführt worden, sondern hätten dann durch
imposante Tordurchgänge in gärtnerisch gestaltete Stadtplätze münden
sollen. 1949 war die Planung von Kurt W. Leucht für das Gebiet südlich der Grunaer Straße
noch als Erweiterung des Großen Gartens vorgesehen (siehe unten).
Abschluss zum Pirnaischen Platz
Das Wohngebiet an der Ausfallstraße Richtung Osten, entstanden ohne Wettbwerb in direkter Vergabe, blieb zum Pirnaischen Platz vorerst ohne Anbindung.
Die gesamte Zentrumsplanung wurde noch vom Ringen um das Hochhaus am Altmarkt,
ebenfalls von Herbert Schneider, in Anspruch genommen.
In seiner Gesamtstadtplanung hätte es jedoch zum Pirnaischen Platz eine Torsituation
gegeben,
ähnlich wie in Ostberlin an der Stalinallee imposante Plätze
beeindruck-en sollten (Frankfurter
Tor oder Straußberger Platz ab 1952).
Noch vor Vollendung des Generalverkehrsplanes begann man 1963 schließlich mit dem Bau
des 14-geschossigen
Appartmenthochhauses, welches als städtebaulicher Abschluss der Magistrale gedacht war.
Ostdeutscher
Städtebau der frühen 50er- Synthese & Transformation
zwischen Moderne und Tradition
Fast zeitgleich entstand in der Südvorstadt die Siedlung an der
Nürnberger Straße (1953-54) von Chefarchitekt Albert Patitz,
seinem Kollektiv (und vor allem von einer entschlossenen Trümmerfrauen/
-männergeneration). Der Neuaufbau dieser ersten Wohnquartiere im ruinenberäumten
Dresden basierte auf folgenden, grundsätzlichen Überlegungen
zur künftigen Stadtentwicklung:
1950: Die Grundprinzipien für die Neuplanung Dresdens
| 1. |
Landeshauptstadt
Dresden ist die Hauptstadt des Landes Sachsen und der Sitz der
Regierung eines Landes der Deutschen Demokratischen Republik.
Dresden ist der zentrale Ort von 1,8 Millionen Einwohnern des
Großraumes.
|
| 2. |
Arbeitsstadt
Dresden ist Arbeitsstadt mit einer mannigfaltigen Veredelungs-
und Fertigwarenindustrie.
|
| 3. |
Kulturstadt
Dresden hat die besonderen Aufgaben einer Kunst- und Kulturstadt
zu erfüllen. Die im Laufe der Geschichte entstandenen Traditionen
und Gegebenheiten und die sich anbahnende kulturelle Entwicklung
bilden hierfür die Grundlage.
|
| 4. |
Besiedlung
der Wohnfläche
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung ist
für die Stadt Dresden eine Zahl von 500 000 Einwohnern innerhalb
der jetzigen Stadtgrenzen zugrunde zu legen. (...) Das Verhältnis
der Wohndichte EW/ ha Wohngrundstücksfläche (überbaute
Wohnbaufläche, Hausgarten und Wohnwege) ist im allgemeinen
mit höchst. 250 als Richtzahl angenommen worden.
|
| 5.
|
Mensch
Die Erfüllung der Forderungen des werktätigen Menschen
hinsichtlich des Wohnens, der Arbeit, der Kultur und Erholung
ist das Ziel der Planung.
|
| 6.
|
Wohnzelle
Eine funktionelle Ordnung der Wohnzellen wird herbeizu-
führen sein. Die kommunalpolitische und städtebauliche
Ordnung der Stadt baut sich vom Wohnbezirk als kleinste Zelle
bis zum Gesamtgefüge der Stadt organisch auf. Hierbei ist
für den lebensfähigen Wohnbezirk die Richtzahl von 5000
bis 6000 Einwohnern zugrunde gelegt worden. (...)
|
| 7.
|
Industrie
Die städtebauliche Einordnung von Industrie und Gewerbe wird
sich mit dem Aufbau der Wirtschaft vollziehen, wobei Arbeitsstätten
und Wohnquartiere planvoll einander zuge-
ordnet werden.
|
| 8.
|
Zentrale
Funktion
Der Stadtkern als zentraler Ort, d.h. als Mittelpunkt der zentralen
Funktionen der Verwaltung, der Wirtschaft und der Kultur basiert
nicht allein auf dem Stadtgebiet Dresden, sondern ebenso auf dem
Großraum und auf dem Land Sachsen. Er wird für die
politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung von weittragender
Bedeutung, im besonderen ein Spiegelbild der künftigen Gesellschaft
sein.
|
| 9.
|
Verkehr
Die Neuordnung des Verkehrs richtet sich nach den Erfordernissen
einer zukünftig anwachsenden Verkehrs-
entwicklung. Hierbei sind differenzierte Verkehrswege den jeweiligen
Funktionen und Bedürfnissen entsprechend vorzusehen.
|
| 10.
|
Grünflächen
Die Gestaltung des Stadtlandschaftsraumes baut sich auf einer
biologisch gegründeten Grünflächenpolitik auf.
Die Landeshauptstadt soll noch mehr als bisher in ihrer natürlichen
landschaftlichen Lage der Stadt der Gärten, der Grünanlagen
von Nutz- und Erholungsgrün, eine Stadt der Hygiene werden.
Dabei bestimmen Bodeneigen- schaften und landschaftliche Gegebenheiten
die Gestalt des Stadtlandschaftsraumes.
|
| 11.
|
Grund
und Boden
Der Neuaufbau kann bei einer grundlegenden Neuordnung des Grund-
und Bodenwertes durchgeführt werden. Hierbei erfordert die
künftige städtebauliche Ordnung die Bildung von Groß-
und Sammelparzellen.
|
| 12.
|
Baudenkmale
Erhaltenswerte Baudenkmale, Natur- und Landschafts-
schutzgebiete bilden einen festen Bestandteil der Neuplanung,
soweit sie der Ausdruck einer vergangenen Kultur und Gegenstand
des allgemeinen Interesses sind. |
aus: Planungsgrundlagen,
Planungsergebnisse. Für den Neuaufbau der Stadt Dresden. Bericht des
Stadtplanungsamtes über die Ergebnisse der Untersuchung der strukturellen
Grundlagen für die neue städtebauliche Ordnung der Landeshauptstadt
Dresden, bearbeitet durch Oberbaurat Leucht, Gartenarchitekt Bronder
und Dipl. Ing. Hunger, Dresden 1950.
(Dort auch umfangreiches Kartenmaterial zu: Dresden. Entwicklung der
Innenstadt; Grünflächenplan; Grossraumplan etc.)
In diesen "Planungsgrundlagen"
von Kurt W. Leucht und Hans Bronder,
der ersten Arbeit über die Planung für
den Wiederaufbau einer kriegszerstörten deutschen Stadt, 1949- 1950
verfasst, heißt es im Punkt 6:
"Wohnen":
"Die Entwicklung im 19. und am Anfang des 20. Jh. führte
zu chaotischen Ballungen der Bebauung in den Städten, insbesondere
in den Großstädten. Die Erkenntnis dieser Tatsache bildet
die Grundlage für eine fortschrittliche Planung, nach der die
für die einzelnen Zwecke genutzten Flächen ihren funktionellen
Beziehungen entsprechend zu gliedern und planmäßig festzulegen
sind. Theoretische Untersuchungen werden in zahlreichen schematischen
Plänen fixiert. Es zeigte sich im weiteren, daß auch die
für die Bebauung vorgesehenen Flächen als überschaubare
und organische Gebilde gestaltet werden müssen, wie sie im natürlich
gewachsenen Dorf und der mittelalterlichen Stadt erkennbar waren.
(...)"
Zu den zentralen Einrichtungen sollte z.B. auch ein
"Zentraler Handwerkerbetrieb" gehören mit "Schneiderei,
Schuhmacherei, Schlosserei, Schmiede, Klempnerei, Installationswerkstatt,
Tischlerei, Malerei für den örtlichen Bedarf in Verbindung
mit einem Kommunalhof für zenrales Gerät, Fahrbereitschaft".
Diese Ideen konnten bei dem Komplex Grunaer Straße durch
TH Prof. Klemm (1916
- 1995) nur durch die Laden- und Servicezeile
umgesetzt werden. Als Einkaufsstraße ist sie nicht konzipiert worden.
Weiter
heißt es im Text: "Die Wohnungen sollen allen neuzeitlichen
wohntechnischen und wirtschaftlichen Erkenntnissen Rechnung tragen.
Der Aufwand zur Unterhaltung und Pflege der Wohnungen muß besonders
im Hinblick auf die werktätige Frau mit einem Minimum an Arbeit
bewältigt werden können. (...)
Eine wichtige Rolle werden beim sozialen Wohnungsbau die in der Entwicklung
befindlichen neuen Konstruktionen und Baumethoden spielen, und zwar
hinsichtlich des Wohnens selbst, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit
- vor allem in bezug auf Unterhaltungskosten -, aber auch hinsichtlich
der schnellen Beseitigung der Wohnungsnot. Die von fortschrittlichen
Architekten der ganzen Welt seit Jahrzehnten erhobenen Forderungen
müssen realisiert und die konservative Auffassung im Wohnungsbau
überwunden werden.
Der Wohnwert wird ferner bestimmt durch richtige Orientierung der
Wohnung zu Sonne, Freifläche und Landschaft, Verkehr und zentrale
Funktionen.
Elastizität der City
(...) Wenn auch
eine zukünftige Entwicklung vielfach eher auf ein Schrumpfen
der City gegenüber den bisherigen Abmessungen als auf eine Erweiterung
schließen läßt, ein Vorgang, der vor allem mit der
Beschränkung der City auf ihre eigentlichen Funktionen zusammenhängt,
soll doch eine hinreichende Elastizität gewährleistet sein.
Geminderter Flächenbedarf
1. Beschränkung der City auf spezifisch zentrale Funktionen des
Landes, des Großraumes und der Stadt
2. Gegenüber
den etwa 94 000 ehemals im Zentrum Wohnenden sollen in Zukunft nur
noch etwa 30 000 innerhalb der Innenstadt untergebracht werden.
3. Technische Vervollkommung des Nachrichtennetzes (Funk, Fernsehen,
Fernschreiben, Telefon) sowie des Filmwesens werden zu einer Entlastung
der City führen."
City ist überall?
Dieser Punkt 3 mutet heute reichlich modern an, denn für 1950
ist die futuristische Vorausschau einer ausgedehnten, sich potentiell
dezentral entwickelnden Stadt des 21. Jahrhunderts, die vorrangig
über elektronische Massenmedien kommuniziert, eine reichlich
hellsichtige Analyse. Auch damals schien man also um das Spannungsverhältnis
zwischen Kern und Peripherie zu ringen, nachdem avantgardistische
Stadttheoretiker in den Jahrzehnten zuvor das Ende der "Alten
Stadt" samt ihres zunehmend engen, luftlosen Stadtkerns verkündet
hatten.
Zusatzfunktionen Grundschule und BSZ
Bereits 1952 komplettierte das neue Stadtquartier ein modernes, berufliches
Schulungszentrum für Bau und Technik (BSZ) an der Günzstraße,
welches auch ein interessantes Beispiel für die Formenvielfalt
architekton-ischen Schaffens in den 50er Jahren in Ostdeutschland
darstellt. Architekt war Gottfried Klingner vom VEB Projektierung
- Sachsen. Ausführungsdetails kamen vom Entwurfsinstitut Prof. Dr.
Ing. Walter Henn der Technischen Hochschule Dresden.
In das neue Stadtquartier wurde ab 1959 auch eine 10-klassige allgemeine
polytechnische Oberschule integriert (siehe: Bilder rechts).
|
|
 
 
 

Appartmenthaus Grunaer Strasse/ Blochmannstrasse, Architekt: W. Hänsch
& Kollkektiv 1954 / 55
 

Gehört diese Architektur in das Schubfach "Nationale Tradition"?
Sachliche Wohnbauten von Prof. Bernhard Klemm

Wohnquartier, hier Seidnitzer Straße, Foto: 1957

Kurt Loose, Sandsteinplastik
"Junge Pioniere", 1955, Grunaer Straße 
Sandsteinrelief am Appartmenthaus
Grunaer Strasse 1954 (Aufn. Aug. 05)
 

Städtisch und doch im Grünen: Inzwischen sanierte Wohnbauten
Grunaer Straße, Mai 2004

Trad. Bauweise, monumentale Moderne: Eckhaus zum Pirn. Platz von 1964-66, Foto: TK, Vergrößerung

Aufgelockerte Bauweise des Quartiers,
April 2005 TK,
Vergrößerung

Überbauung Seidlitzer Straße mit Toreinfahrt. drei Fotos von S.Baumgärtel, 2005 
  
Zurückhaltende Reminizensen an lokale Bautraditionen - Loggien
mit Werkstein- akzentuierungen

Teil des Quartiers: Moderne Bauschule an der Günzstraße,
1952 / Unter der Traufkante ist ein Schriftband mit Agitation- und
Propagandasprüchen erkennbar. Bemerkenswert ist die moderne Typographie.
(Aufn. 2005)
Textbeginn: "Wo das arbeitende Volk ..."
 

Der Meister zeigt einem Bauschüler den Weg: Bronzekunstwerk im
Agit-Prop-Stil

Detail einer Hauswand an der Zirkusstraße
|
 Bebauungsplan
Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang
der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.
Bebauungsplan
Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang
der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.