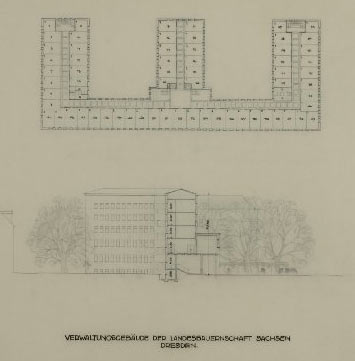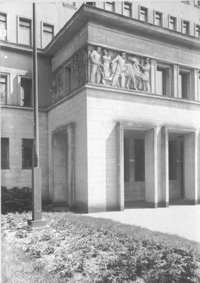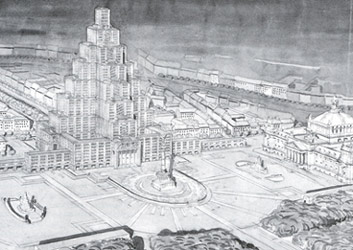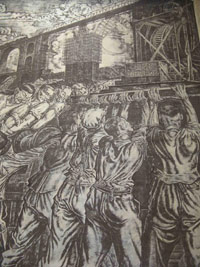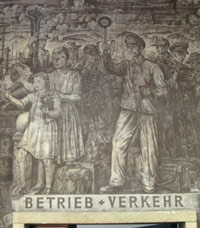|
| Architekt: |
|
Otto
Kohtz |
Reliefs:
_
._
weitere bau-
gebundene Kunst: |
|
Herbert
Volwahsen
Otto
Rost,
Sizzo Stief, Paul Rössler,
Hans Nadler |
| Bauzeit: |
|
1936- 38 |
| Adresse: |
|
Ammonstraße 8 |
|
heutiger Nutzer: |
|
Deutsche Bahn |
Der
kammartige, lang gestreckte 5-stöckige Verwaltungsbau, hervorgegangen
aus einem Wettbewerb, war ein Gebäude für die sächsische "Landesbauernschaft"
in repräsentativ-sachlicher Formensprache. Von der Ammonstraße
präsentiert sich das Haus mit
einer an den Seiten herausragenden Sockelzone aus Werkstein und einem
sich darüber drei Stockwerke erhebenden Hauptbau, der durch einen
überdachenden Sims seinen Abschluss findet. Nach hinten
öffnen sich kammartige Flügel.
Für das Bauen im Dritten Reich eher untypisch: ein äußerst
flach geneigtes Dach, das man von der Fußgänger-perspektive
als Flachdach wahrnimmt. Es bestand ursprünglich aus verzinktem Eisenblech.
Lange monotone Fensterreihen als sachliche Lochfassade sind typisch
für eine in der NS-Zeit fortlaufende Moderne, wie man sie in
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verstand. Dabei ist ebenso ungewöhnlich,
dass die Fenster keine Unterteilung in Sprossen erhielten. Einziger
Gliederungspunkt bildet das hervor gerückte Entrée als machtvoll kantiger
Vorbau. Durch sieben (magische Zahl) offene, streng rechtwinklige
Tore gelangt man in die Vorhalle, die das Gebäude durch ein großzügiges
Treppenhaus weiter erschließt.
Auffällig ist der Verzicht auf die ansonsten in der NS-Architektur
gern verwendete Betonung der Vertikalen. Ganz im Gegenteil ist dieses
Bürohaus ganz in die horizontale Breite gelagert. In der Architekturzeitschrift DBZ wurde damals die zweckmäßige u. klare Grundrissform positiv hervorgehoben, ebenso der monumentale Ausdruck.
Die Formenstrenge des Gebäudes wurde aufgelockert durch seitlich
angeordnete Pergolen (heute nicht mehr vorhanden).
Aufgrund Eisenmangels konnte das Gebäude bereits vor Ausbruch des II. Weltkrieges nur in Pfeilermauerwerk errichtet werden. Lediglich der Mittelteil mit rückwärtigem Flügel wurde als Stahlskelett ausgeführt.
Im Kellergeschoss wurden bereits 1937 sechs Luftschutzräume
eingerichtet.
Pläne,
Detailskizzen, Zeichnungen, Grundrisse
des Gebäudes
auf
der Webseite der TU Plansammlung
(siehe Verwaltungsgebäude der Sächs. Bauernschaft)

Perspektivische Ansicht - 1938 (Bildquelle: TU Berlin)
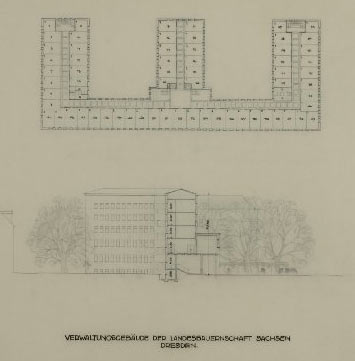
Grundriss 4. Etage
- 1938 (Bildquelle: TU Berlin)
Nahrung für das "Herrenvolk"
Ein besonderes Kennzeichen, welches den Bau als Verwaltungsgebäude
der Sächsischen Bauernschaft ausweist, waren die an den Ecken
des Vorbaus angebrachten Relieftafeln "Pflanzen und Säen"
und "Ernten" von Herbert Volwahsen, beide kurz nach dem
Zusammenbruch des NS-Reiches 1945 von den neuen Machthabern entfernt.
Ebenso der Reichsadler genau in der Mitte über dem 4. Tor mit
der Runenschrift "Blut und Boden" - an deren Stelle man,
der neuen Funktion des Hauses als Verwaltungsbau der "Deutschen
Reichsbahn" gemäß, eine neue Sandsteinplastik anbringen
ließ, die ein geflügeltes Eisenbahnrad darstellt.
Das vor 1945 angebrachte bildkünstlerische Werk unterstreicht auf
suggestive Art und Weise die metapherngeschwängerte Propaganda
von "Scholle" und "Heimaterde", welche bewusst
als Gegenreflex zu Moderne und Internationalisierung eingesetzt wurde.
Der ehemalige Meisterschüler von Karl Albiker an der Dresdner
Akademie Herbert Volwahsen schien kein Problem zu haben, die ideologiegesättigte
rassische Politik des NS-Staates künstlerisch in Stein zu meißeln.
(Zu Biografie und Werk von Herbert Volwahsen siehe unten)
Weitere NS-Kunstwerke fertigten der Dresdner Maler und
NSDAP-Mitglied seit 1935 Sizzo
Stief (Sgraffito am Mittelflügel des Portales zur Feldgasse - jetzt nicht mehr vorhanden) und der Dresdner Professor
Paul
Rössler, der das ehemalige Hallengemälde schuf (jetzt ebenfalls nicht mehr vorhanden).
Im 1. OG waren zwei Sgraffitogemälde von Hans Nadler zu sehen
('Forstwirtschaft und Gartenbau). Prof. Paul
Börner (Meißen) schuf im Sitzungssaal ein großes Gemälde zum Thema
Bauernarbeit.
Zur Entstehungszeit 1938 strahlte dieser kompakte neue Bürobau
in der kleinteiligen Wilsdruffer Vorstadt Dominanz und Härte
aus. Heute geht er am Beginn des Wiener Platz-Tunnels nahezu in der
Wahrnehmung der Dresdner Öffentlichkeit unter. Nur in wenigen
Architekturführern taucht dieses Gebäude auf - bewusste
Verdrängung einer unbequemen Vergangenheit?
Zur DDR-Zeit wurde jene selbstreflektierende Öffentlichkeit durch
einen staatlich verordneten Antifaschismus an einer persönlichen
Aufarbeitung der eigenen Verstrickung mit dem NS-System gehindert.
Heute ist die Beschäftigung mit Kunst und Wirklichkeit des NS-Terrorsystems
in Ostdeutschland nicht mehr tabuisiert. Angesichts eines beunruhigend
aufflammenden Rechtsradikalismus im Freistaat Sachsen ist eine aktive
Auseinandersetzung mit der Entstehungs-geschichte des deutschen Faschismus,
ausgelöst gerade vielleicht durch diese sichtbaren Relikte aus
der dunkelsten Zeit unseres Landes, von immens hoher Bedeutung.
Die Moderne im nationalsozialistischen Deutschland
Die Moderne brach in Dresden der NS-Zeit nicht abrupt ab. Stadtbaurat
Wolf lenkte die städtebaulichen Entwicklungen von 1923 - 1945
! Seine in vielen Gebäuden nachweisbare Überzeugung für
die Ideen des "Neuen Bauens" versuchte er auch im Dritten
Reich aufrecht zu erhalten.
Zwar wurden vom Bauministerium in Berlin bei Wohnhäusern "Deutsche
Giebel" vorgeschrieben, aber in öffentlichen Bauten spielten
moderne Gestaltungsmittel weiterhin eine Rolle. Allerdings wurde besonderer
Wert auf eine klassische symmetrische Ordnung gelegt. Die
ausgestellte Sachlichkeit der autoritären Moderne korrespondierte
zudem "perfekt" mit dem deutschen Bürokratismus, dem blinden
Effizienzstreben und dem Drang nach geometrischer Ordnung der
NS-Diktatur.
Reichsnährstand
Der Reichsnährstand, gegründet am 13.9.1933, war eine Organisation,
die alle Betriebe, Personen und Verbände der Ernährungswirtschaft
zwangsweise zusammenfasste. Sie unterstand der Leitung des "Reichsbauernführers"
Walter Darré, der zugleich das Amt des Reichsministers für Ernährung
und Landwirtschaft bekleidete. Die volle agrarische Autarkie sollte
durch Schutz vor dem Wettbewerb mit dem Ausland erreicht werden. Ein
gleich bedeutendes Ziel Darrés war es, das für ihn "rassisch gesunde"
Bauerntum zu fördern und damit einen Beitrag zur Erhaltung der "nordischen
Rasse" zu liefern. 1939 hatte der Reichsnährstand über 14 Millionen
Mitglieder.
Das "Gesetz über den Aufbau des Reichsnährstandes" löste alle Genossenschaften
und Handelsorganisationen für landwirtschaftliche Produkte auf. An
ihre Stelle trat der Reichsnährstand, der die Preise und die Marktordnung
festlegte. Das "Reichserbhofgesetz" vom 29.9.1933 legte z.B. fest,
dass der Erbhof ungeteilt an den ältesten Sohn überging, sofern dieser
seine "arische Reinrassigkeit" seit 1800 nachweisen konnte.
Wikipedia:
Reichsnährstand, unterteilt in 26 Landesbauernschaften. Der in
Dresden geborene
Hellmut Körner war "Landesbauernfüher" Sachsen.
Zwangsarbeit in der Landwirtschaft
Neben der Bau – und Rüstungsindustrie litt am stärksten die Landwirtschaft
unter dem Arbeitskräftemangel. Es bestand auch erhöhte Ablieferungspflicht
für landwirtschaftliche Produkte aufgrund des Krieges, dies verstärkte
den Bedarf an Arbeitskräften. Hier wurden Kriegsgefangene und "Fremdarbeiter"
vor allem aus dem Osten eingesetzt, um die Nahrungsmittelproduktion
zu sichern. Reichsnährstand und Arbeitsamt organisierten den Arbeitseinsatz
der ausländischen (Zwangs-) Bauern.
Die landwirtschaftliche Ausbeutung und Verknechtung Polens, der Ukraine,
Tschecho-Slowakei und anderer osteuropäischer Länder für
die dirigistische, staatlich gelenkte Nahrungspolitik im NS-System
wurde u.a. vom Reichsnährstand organisiert.
Ganz normale DresdnerInnen
Es mag sicher nicht in eine Architekturabhandlung gehören, aber
trotzdem - stadtgeschichtlich wäre eine Aufarbeitung des ganz
normalen NS-Alltages, in dem Tausende "ganz normaler" Dresdner
und Dresdnerinnen den vermeintlichen "Sozialismus" für
reinrassig reine Angehörige "deutschen Blutes" organisierten,
während "lebensunwertes Leben" und "den Volkskörper
schädigende" jüdische Mitbürger unter stillschweigender
Hinnahme der Bevölkerung abtransportiert und vergast wurden,
eine dringende Aufgabe.
Literaturtipp:
Götz,
Aly: Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus,
Frankfurt Main 2005
Donath, Matthias: Architektur in Dresden 1933-1945, Dresden 2007,
Edition
Sächsische Zeitung
Ellrich Hartmut:
Dresden 1933 - 1945. Der historische Reiseführer, Berlin 2008
-----------------------------------------------------------
|
|
      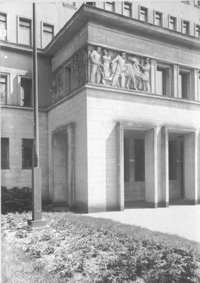  
Reliefs von Herbert
Volwahsen, Foto: ca. 1938

Leerstelle am ehemaligen
Relief "Pflanzen und Säen", Fotos: 2004

Im hierarchisch vorgerückten Entrée befanden sich exponiert im 1. OG die Räume des "Landesbauernführers". 
Die Fruchtkörbe in Sandstein fertigte
NSDAP-Mitglied Otto Rost, der 1955 in der folgenden Diktatur die Arbeiterfiguren am "Haus
Altmarkt" ebenfalls aus dem weich-nachgiebigen Elbsandstein formte.

Eingangshalle 1938 mit Sgraffito von Prof. Paul Rössler (Dresden) mit
Szene aus der Landwirtschaft - hier Schafherde mit Schäfern,
Vergrößerung

Ehem. Gebäude der Landesbauernschaft von der Feldgasse, Foto: 03/2019
TK
Vergrößerung
|
|
Wandfresken
der "Deutsche Reichsbahn" 1948
Zwei zeithistorisch äußerst interessante Wandfresken
befinden sich als Kunst am Bau in der breit gelagerten Eingangshalle.
Sie wurden noch vor der Gründung zweier getrennter deutscher
Staaten geschaffen und künden von der Umnutzung des Gebäudes.
Nur noch zwei sandsteinerne Fruchtkörbe (von Otto Rost) weisen an der Treppe
auf den ursprünglichen Zweck des Verwaltungsbaus hin.
Die beiden Nachkriegskunstwerke im zeittypischen Agit-Propstil rechts
und links an den Stirnseiten sind mit "Planung und Bau"
bzw. "Betrieb und Verkehr" betitelt. Sie stellen einerseits
die intellektuelle Führung eines zentral angeordneten Planungskollektivs
mit einem leitenden Ingenieur dar, den hart arbeitende Gleisbauer
im Umfeld flankieren. Besonders auffällig sind die betont ernsten,
vom Krieg stark gezeichneten Gesichter. Eindrucksvoll überträgt
sich auf den heute Betrachtenden das zupackende gemeinsame Engagement
der Gruppe, welche mit ganzer Kraft ein Gleis hoch stemmt. Ein bewegter
Wolkenhimmel und dynamisch rauchende Schornsteine unterstreichen zudem
die Aufbruchstimmung im noch ungeteilten Deutschland. Am linken Bildrand
zeichnet sich die Silhouette der im Wiederaufbau befindlichen Elstertalbrücke
im Vogtland ab.
Das sich gegenüber befindende Fresko erzählt vom sozialen
Leben auf und mit der deutschen Bahn. Vor einem Erzgebirgsausflügler
mit Skiern steht ernst und statuarisch eine Mutter mit ihrer Tochter,
die mit Blumenstrauß einen Ankommenden willkommen heißt.
Ein andere Figur stellt einen Reichsbahnmitarbeiter dar, der einer
alten Frau mit Stock stützend behilflich ist.
Ästhetisch passt diese grafische schwarz-weiß Kunst, die
in den frischen Putz gekratzt wird, ganz in den Zeitgeschmack einer
gegenständlich-konkreten, propagandistisch gefärbten (ost-)
deutschen Nachkriegskunst. Stilistisch knüpfen die Darstellungen
allerdings auch an die wenig abstrakte Heimatkunst während der
30er und frühen 40er Jahre innerhalb der offiziellen NS-Ästhetik
an.
Die Fresken wurden von der Deutschen Bahn AG (als Rechtsnachfolgerin
der Deutschen Reichsbahn), wie das gesamte Haus, 2004 umfassend saniert.
Sie sind in der Eingangshalle durch die Öffentlichkeit an Werktagen
frei zugänglich.
Denkmalschutz
Das Gebäude steht als ein repräsentatives Bürogebäude der späten
1930er Jahre und als wichtiges historisches Zeitzeugnis unter
Denkmalschutz.
Der Architekt: Otto Kohtz
1880 (Magdeburg)
bis 1956 (Berlin)
Kohtz gilt als Visionär des Hochhausbaus im Kaiserreich und der
Weimarer Republik. Sein Leben lang zeichnete er (völlig erfolglos)
himmelstürmende Hochhauskulissen. Zum Beispiel plante Kohtz 1920 eine
architektonische und städtebauliche Vision für den Berliner Spreebogen.
Das "Reichshaus" genannte Gebäude sollte als 200 Meter
hohe Stufenpyramide entstehen, in der zahlreiche Reichsbehörden zusammen-gefasst
werden sollten.
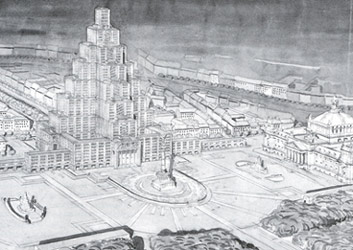
Otto Kohtz. Entwurf
für ein Reichshaus am Königsplatz 1920/21 - rechts Reichstag. Vergrößerung
Otto Kohtz kritisierte
in den 20er Jahren das deutsche Mietskasernensystem von engen lichtlosen
Hinterhöfen.
In mehreren Schriften verwarf er die Idee einer Sanierung und Entkernung
der Arbeiterquartiere aus finanziellen Gründen. Die einzige Lösung
für das Problem bestünde in ",deutschen Hochhäusern", in
Distanz zur amerikanischen Bauweise in New York.
Bereits kurz nach der Jahrhundertwende hatte Otto Kohtz himmelstürmende
Architekturphantasien kreiert, wie diese 1909 für Marburg.

Hochhaus für Marburg 1909:
Bildquelle: „Hochhaus. Der Beginn in Deutschland",
von Rainer Stommer, Marburg 1990.
Seine Skizzen, veröffentlicht in dem Buch „Gedanken über Architektur",
waren Ausdruck für die Suche nach einer neuen Ästhetik der Monumentalarchitektur.
Seine Vorbilder sind in den babylonischen und assyrischen Bauten zu
suchen, die seit 1899 durch deutsche Archäologen ausgegraben wurden.
Dass er im Gebäude des Dresdner Reichsnährstand eher die Horizontale
als die Vertikale betonte, lässt sich wohl durch das Wirken von
Stadtbaurat Paul Wolf erklären, der in den späten 30er Jahren gerade
an der Sanierung der Frauenkirche arbeitete und die historische
Silhouette der Dresdner Altstadt vor übermäßig hohen Gebäuden schonen
wollte. Allerdings kann man auch eine gewisse Stufung, also die
Wiederkehr des Motivs eines pyramidal geschichteten Aufbaus, in dem
Gebäude zwischen Machtdominanz und Sachlichkeit erkennen.
Zudem
erstaunt, dass Paul Wolfs Behörde zeitgleich ein deutlich sichtbares
Hochhaus am neuen Fischhofplatz, keine 500 m Luftlinie, im Zuge
der Altstadtsanierung plante, was aber dann wegen Beginn des II.
Weltkrieges nicht mehr zur Ausführung kam.
Bauten (u.a.)
- Verwaltungsgebäude für den Reichslandbund - „Bund der
Landwirte“ (1909-11, auf Grund 3. Preis 1908 bei
Wettbewerb)
in (Berlin-Kreuzberg)
Wettbewerb Fassade
- 1922-23 - eigene Villa Kohtz in der
Schweinfurthstraße 24
in Berlin Dahlem
- 1929 Potsdam Babelsberg "Ton-Kreuz", dem ersten
Tonfimstudio der "Ufa".
Weitere Werke von Kohtz u.a. auf:
In den Himmel bauen. Hochhausprojekte von Otto Kohtz (1880–1956).
Von Wolfgang Schäche, Brigitte Jacob, David Pessier, Berlin 2014
Siehe auch:
www.deutsche-biographie.de
Literatur:
W. Hegemann, H. Hammer-Schenk: Otto Kohtz , Gebr. Mann Verlag; 1996
Kohtz, Otto: Otto Kohtz. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann.
EA. Berlin : Friedrich Ernst Hüsch Verlag, 1930.
DBZ 12/1938 S.
K 362
|
|
    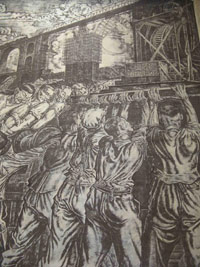
Vergrößerung
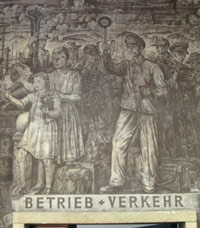    
Aufnahmen: April
2005 (T. Kantschew) - historische Fotos: SLUB/ Fotothek Dresden
|
|
Bildhauer:
Herbert
Volwahsen (1906-1988)
arbeitete auch nach der NS-Zeit weiter als Künstler
am Bau.
Nach der Kapitulation 1945 wirkte er mit am Dresdner Institutsgebäude
der ehemaligen Pädagogischen Hochschule auf der Wigardstaße
von 1952. Auf der traditionellen Sandstein-Putzfassade ist eine Friesgestaltung
am Portal von Herrn Volwahsen zu sehen (siehe Bild rechts).
- Plastik auf dem Striesener Friedhof in Dresden
-
Totentanz (Kalkstein-Relief auf dem Gertraudenfriedhof
in Halle) von 1946-48
-
Merkurbrunnen
1963 in Bielefeld
Herbert Volwahsen
wurde 1906 in Schlesien geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in
Breslau erlernte er in Warmbrunn im Riesengebirge das Holzbildhauerhandwerk.
Von 1925 - 1931 studierte er an der Kunstakademie in Dresden bei den
Professoren R. Born und Karl Albiker.
1929 »Meisterschüler« der Dresdner Akademie. 1933 erhielt er den Kunstpreis
der Sächsischen Regierung für die »Geblendete«. Wenige Monate nach
der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten bekannte er sich im Juni
1933 öffentlich zum nationalsozialistischen Kunstverständnis.
1933
erhielt er den Ilgen-Kulturpreis des Landes Sachsen für die Skulptur
Die Geblendete. Von 1935 bis 1953 hatte er sein Atelier im
Künstlerhaus Dresden-Loschwitz. Er schuf 1936-37 die Kanzel und eine
Martin-Luther-Statue
für die Martin-Luther-Kirche in Berlin Lichterfelde.
1946 organisierte
Volwahsen die
»1. Deutsche Kunstausstellung Dresden« in Zusammenarbeit mit Karl
Hofer, Will Grohmann, Joseph Hegenbarth und Max Pechstein in der die
vom Nationalsozialismus verfemte Kunst vom Expressionismus bis zu
den Abstrakten erstmalig wieder gezeigt wurde. 1952 erhielt er den
»Kunstpreis der Stadt Köln«. 1953 übersiedelte er in die Bundesrepublik.
Aufenthalte in München, Darmstadt, Paris, Rom. 1956 wurde er als Leiter
der Werkgruppe Plastik an der Werkkunstschule in Bielefeld berufen.
Von 1964 bis 1972 lehrte er an der Fachhochschule in Dortmund. Der
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen verlieh ihm den Titel »Professor«.
Mehr Infos unter:
Textquelle:
www.saxonia.com/galerie/002676.htm
Weitere Infos:
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Volwahsen
Bildhauer:
Otto Rost (1887 - 1970)
1909 - 14 Studium
Kunstgewerbeschule Dresden
1916 - 23 Schüler von Georg Wrba
1933 Eintritt in die NSDAP
1939 - 45 Nach Tod Wrba sein Nachfolger + Lehrer für Bildhauerei an
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Dresden, quasi
"Professor" (ohne Beamtenstatus)
Ab 1946 bis ca. Mitte der 1950er Jahren der DDR
Mitglied der
„Gebiets-Auftragskommission“ für künstlerische
Gestaltung von Bauten im Bezirk Dresden, zeitweise ihr Vorsitzender. Rost war
(mit-)verantwortlich für
die Vergabe zahlreicher Aufträge beim Wiederaufbau Dresdens.
Werke
(u.a.)
1922
- Kriegerdenkmal Döbeln
1934 - Zwei überlebensgroße Statuen für das
Reichsgericht
in Leipzig: 'Gemeinnutz'
und 'Eigennutz'
1936 -
Rugby-Kämpfer für die Olympiade in Berlin (Preis)
1937 - Sandsteinfigur "Große Knieende"
(Foto: T.Kantschew 2019)
1938 -
Bronzeplastiken Keiler und Bär am Neuen Jägerhaus
vom Schloss Grillenburg
1939 - Industrie- und Handelskammer Cottbus, zentrales
Giebelrelief (Info)
Figurenpaar
„Arbeiter der Faust und der Stirn“
Foto: T.Kantschew 2005
Büste von Adolf Hitler
1942 - Beteiligung an 'Grosse Dresdner
Kunstausstellung'
Brühlschen Terrasse mit 'Sportkameradinnen',
'Psyche',
'Knieende Haarflechterin' und anderen
Plastiken
1943 - Porträtbüste vom Stabschef der SA Wilhelm
Schepmann (Gezeigt auf der Großen Dresdner
Kunstausstellung 1943, Dresdner Künstlerbund)
1945 - Sowjetisches Ehrenmal für die sowjetischen
Gefallenen der 5. Gardearmee (ehem. Platz der
Einheit)
1952 - Rekonstruktion der Barockfigur "Diana" auf dem Dach
der Humboldtuniversität Berlin
1952 - ‘Mauersberger Totentanz’,
10-Meter-langes Relief in
der Kreuzkapelle Mauersberg
1953 - Bauplastischer Schmuck im
Abschnitt D (Nord) der
Stalinallee in Ostberlin (Architekt: Kurt W. Leucht):
Keramik-Rosetten, Ornamentfriese für die Fassade
Karl-Marx-Figur auf dem "Platz der Einheit" in Dresden
Neustadt (Albertplatz), bald darauf wieder demontiert.
1956 - Figurengruppe am Portal Haus Altmarkt Dresden
Weitere Infos zu Otto Rost
www.germanartgallery.eu (Fotos seiner Werke)
Ernst-Günter Knüppel: „Otto Rost – Leben und Werk
1887-1970. Bildhauer in Dresden und Döbeln"
Verlag:
Sachsenbuch 2006
Text: Thomas Kantschew im wesentlichen 2004
Der
Wikipedia-Artikel übernimmt 2018, teils wörtlich,
große Teile dieses Textes.
|
|


Fruchtkorb von Otto Rost

Sowjetisches Ehrenmal von Otto Rost, eingeweiht am
25.11.1945 auf dem Albertplatz (jetzt: Olbrichtplatz)
Auftragsarbeit
von der sowjetischen Militäradministration, Foto: 12.02.2005
T.Kantschew,
Vergrößerung
|