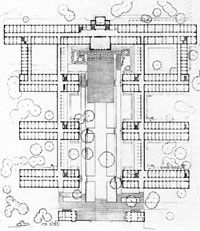|
Architekt: Wilhelm
Kreis
Plastiken: Karl Albiker
Bauzeit: 1938
Wiederaufbau zerstörter Teile: 1945 von Wolfgang Rauda
Adresse: August Bebel- Straße 19
Der
ausgedehnte Gebäudekomplex des ehemaligen Dresdner Luftgaukommandos
beherbergte bis 1945 das Luftgaukommando IV der deutschen Luftwaffe.
Nach Beendigung des II. Weltkrieges diente das Gebäude bis 1952
der Landesregierung und dem Sächsischen Scheinparlament einer
"Einheitsfront". Heute ist das Gelände eingeschränkt
öffentlich zugänglich.
"Eines der wenigen öffentlichen Gebäude, die zur Zeit
der nationalsozialistischen Herrschaft in Dresden entstanden, war
für das Luftgaukommando bestimmt. Den Wettbewerb gewann mit Wilhelm
Kreis einer der bemerkeswertesten Architekten, der damals in Dresden
tätig war. Er konzipierte den Komplex mit einer Hauptmagistrale,
die direkt auf das dreigeschossige Hauptgebäude zuführt.
Zu deren Seiten sind jeweils drei zweigeschossige Gebäude parallel
angeordnet. Den einzigen Schmuck des stengen Baues bildet der Figurenfries
"Fliegender Genius" über der portikusähnlichen
Eingangshalle von Karl Albiker, Rodin-Schüler und Professor der
Dresdner Akademie. Bis 1990 wurde das Gebäude von der Militärakademie
"Friedrich Engels" genutzt. Seit 1990 sind u.a. Dienststellen
der Bundeswehr untergebracht."
(Architekturführer Dresden, 1997)
Die Militäranlage wurde ebenso wie das Hygiene-Museum inmitten
eines Gartens seiner königlichen Majestät hineinge- baut,
deren Grundstücke fast ausnahmslos nach der Revolution 1918 vom
Freistaat Sachsen enteignet worden waren. Einige alte Bäume des
ehemaligen Parks sind immer noch auf dem Gelände vorhanden. (Foto:
Park im Garten der königlichen Villa, Aufnahme: vor 1938)

Kantige Modernität und irritierend pessimistische Kunst
Das Albiker-Relief ordnet sich in das Gestaltungsprinzip der Hauptfassade
unter. Über die gesamte Breite der fünf hochstehenden Fensterformate
zieht sich der
längliche Fries mit der idelaisierten Heldengestalt, umrahmt
von hämmernden Männerfiguren. Der "Genius", welcher
als Ikarusassoziation in der griechischen Mythologie an seiner eigenen
Hybris verbrennt, muss sich seltsam beugen, damit er in den niedrigen
Fries hineinpasst, anstatt, wie sicher von der Aussage des Künsters
gewünscht, sieghaft hinauf zu fliegen. Liest man das Relief von
links nach rechts läßt ein seltsamer Eindruck von Rückwärtsfallen
erstaunliche Skepsis aufkommen. Oder war gerade dieser feine subtile
Zweifel an der pathetisch aufgeblähten Nazipropaganda von Albiker
gewollt? (Allerdings gibt es auch Figuren des Bogenschützen, des
Geheimdienstlers und der Abwehr.)
Zusätzlich zum Albiker-Relief finden sich am Hauptgebäude
12 dekorierende Reliefs über den Erdgeschossfenstern, die die
Sternkreiszeichen darstellen (im Bild: Widder). Weiterer Schmuck findet
sich u.a. in den kantigen Obelisken, die den Herrschaftsanspruch dieses
Gebäudekomplexes hart unterstreichen, mit jeweils dreiarmigen
Leuchtern an den Seiten, aber auch im Inneren des Haupthauses.
Ein großteil der schmückenden Ausgestaltung mit Relieftafeln,
Wandbildern und freistehenden Skulpturen ist nach 1945 abgeschlagen
worden. Das Albiker-Relief konnte nur durch Proteste der Kunstakademie-Studenten
und später von Lea Grundig vor einer bilderstürmenden Zerstörung
bewahrt werden.
Strenge Axialität
als Gegenprinzip zur freiheitlichen Stadt
Typisch für die Betonung einer vermeintlich "urdeutschen"
Architektur sind auch hier das hohe Walmdach, hochstehende Fenster
und eine strenge, hervorgerückte Eingangshalle aus Travertinstein,
die den zentralen Versammlungssaal durch fünf über zwei
Geschosse verlaufende Fenster auch von außen erkennen läßt.
Die auf diese Halle zulaufende Symmetrie der Haupt-magistrale inszeniert
straffe Ordnung, Hierarchie und Führerprinzip auf suggestive
Weise. Die Welt erscheint in dieser Wehrmachtsanlage zwingend in einem
orthogonalen Raster, planbar, auf gewaltsame (Unter-) Ordnung und
Disziplin ausgerichtet, unter Aufgabe von Individualität und
persönlicher Freiheit.
Die identischen kammartigen Seitenflügel des Komplexes sind in
Stil und Duktus dem Hauptgebäude untergeordnet, bestehen ebenso
aus einer Putzfassade, desen Vorderfront durch eine mittelseitige
Betonung in Werkstein hervor-gehoben wird. Die Seitenflügel sind
alle mit noch niedrigeren Verbindungsgängen optisch, funktional
und symbolisch als eine Einheit zusammengefaßt.
Internationale Architektur- und Städtebauströmungen
Ein vergröbernder Neoklassizismus und national
auftrumpfender Monumentalismus, der Tradition und Aufbruch in die
Moderne heroisch zu verknüpfen suchte, ist in den 1930er und 40er
Jahren weltweit anzutreffen, so z.B. in der Central Library in Manchaster
1934 (Foto), am
Senate House in London 1932-37,  am
Palais de Chaillot zur Weltausstellung 1937 in Paris oder an vielen staatlichen Gebäuden
in den USA, wie z.B. in Washington die
National
Gallery of Art 1936-40 oder das national-pathetische Jefferson
Memorial an der Mall 1934-36, in Italien (Esposizione Universale-
Weltausstellung 1942 und Città Universitaria 1932-34 in Rom), der
UdSSR (Lenin-Mausoleum 1930), in Tokio das
Parlamentsgebäude (vollendet 1936)
oder in Argentinien (Universität Buenos Aires).
Bereits der Palast des
Völkerbundes 1927 in Genf hatte einen Sieg des klassizistisch
orientierten Traditionalismus bedeutet, da sich der Entwurf des Schweizers
Hans Meyer gegenüber dem eigentlichen Wettbewerbssieger Le Corbusier
letztlich durchsetzen konnte. am
Palais de Chaillot zur Weltausstellung 1937 in Paris oder an vielen staatlichen Gebäuden
in den USA, wie z.B. in Washington die
National
Gallery of Art 1936-40 oder das national-pathetische Jefferson
Memorial an der Mall 1934-36, in Italien (Esposizione Universale-
Weltausstellung 1942 und Città Universitaria 1932-34 in Rom), der
UdSSR (Lenin-Mausoleum 1930), in Tokio das
Parlamentsgebäude (vollendet 1936)
oder in Argentinien (Universität Buenos Aires).
Bereits der Palast des
Völkerbundes 1927 in Genf hatte einen Sieg des klassizistisch
orientierten Traditionalismus bedeutet, da sich der Entwurf des Schweizers
Hans Meyer gegenüber dem eigentlichen Wettbewerbssieger Le Corbusier
letztlich durchsetzen konnte.
Man könnte die These aufstellen, die schwere monumentale Neoklassik
war auch ein "Internationaler Stil", bevor die damaligen
Theorien der enthistorisierten deutsch-schweizer Bauhausmoderne weltweit
Verbreitung fanden. Diese war zwar nicht minder pathetisch, setzte
aber weniger auf Klassizität und klassische Ordnungssysteme wie
Symmetrie und Achsen in Fortführung tradierter Herrschaftsgesten
und Welterklärungsmodelle. Selbstverständlich gibt es eine
Unmenge Mischformen und fließender Übergänge, wie
z.B. die italienische Kunsthistorikerin Donata Pizzi kürzlich
in ihrer Ausstellung "Metaphysical Cities" über Architektur
neuer Städte der 30er und 40er in Italien und Nordafrika aufzeigte.
(Im faschistischen imperialen Italien suchte man eine Begegnung von
Modernität und Tradition durch eine Verbindung von Esprit Nouveau
und albertinischer Civitas zu erreichen.)
Städtebau
Städtebaulich erinnert die Dresdner Anlage von Kreis an das neue
Regierungsviertel in der türkischen Hauptstadt Ankara, das von
Hermann Jansen und
Clemens
Holzmeister 1934-38 in ähnlichen Prinzipien (Axialität,
Symmetrie, perspektivische Zielausrichtung) für die Einparteien-Republik
Atatürks gebaut wurde. Die moderne Neoklassik wirkte dort bis
in die 50er Jahre, wie z.B. am Atatürk-Mausoleum 1941-1953. (2
Fotos von TK 2004.)
Die beiden neuen Hauptstädte Moskau (seit 1922) und Ankara (seit
1923) orientierten sich beide an imperialer Klassizität, allerdings
wie auch Washington aus unter-schiedlichen klassizistischen Prägungen
("Beaux-Arts-Architecture" um 1900, St. Petersburger Klassizismus).
Selbstverständlich wirkten diese internationalen Impulse der
30er Jahre auch auf Deutschland zurück.
In Dresden wurde
diese kammartige, symmetrische Struktur im TU-Viertel 1953- 55
mit dem Trefftzbau
von Walter Henn und Heinrich Rettig variiert. Henn hatte von 1934
bis 1937 Architektur an der Dresdner Akademie der Bildenden Künste bei
Wilhelm Kreis studiert.
Kreis - ein politischer Wendehals
Der Architekt Professor Wilhelm Kreis (1873 bis 1955) ist einer der
umstrittensten Baumeister des 20. Jahrhunderts. Als politisch instinktvoller
Wendehals hat er es fertig gebracht, von der Kaiserzeit, über
die Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus bis in die westdeutsche
Bundesrepublik erfolgreich tätig zu sein. Das umfangreiche Schaffen
umfasste auch den Bau von Fabriken, Kur- und Warenhäuser, Museen,
den Bahnhof Meißen oder Möbel für den Deutschen Werkbund. Auch das
Deutsche Hygiene-Museum (1927--1930) sowie die neue Augustusbrücke
(1907- 10) in Dresden sind von Kreis.
„Ich wollte stets monumental arbeiten"
sagte Kreis nach dem Krieg. „Und dazu benötigt man die entsprechenden
Auftraggeber." Den Hang zum Monumentalen verdankte Kreis seinem Lehrer
August von Thiersch in München. Paul Wallot berief den jungen Architekten
1899 an die Dresdner Kunstgewerbeschule, wo er ab 1902 eine Professur
innehatte. Bereits vor seiner Berufung war Kreis durch die Entwürfe
für die so genannten Bismarck-Türme bekannt geworden (insgesamt 46
gebaut).
Kurzbiografie:
1893-97 Studium an der TH München, Karlsruhe, Berlin-Charlottenburg
und Braunschweig.
1899 Assistent bei Paul Wallot (Ständehaus Dresden)
1902-08 Professor an der Kunstgewerbeschule Dresden 1909-20 als Nachfolger
von Peter Behrens.
1920-26 Professor an der TH Dresden
1927 Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste Berlin.
bis 1941 Leitung der Architekturabteilung der Staatlichen Hochschule in Dresden (ab 1938 als deren Rektor)
in der Nazizeit Generalbaurat für deutsche Kriegerfriedhöfe
1954 - Entwurf für den Neubau der Bonner Beethovenhalle "leicht.
gläsern, freundlich zwischen Bäumen liegend.
Das Dach tänzelt auf hochhackigen Stahlbetonstilettos einher, alles
in diesem Entwurf war gläsern und schwebend." (www.perlentaucher.de)
siehe auch: DNN-Artikel
(100 Dresdner des Jahrhunderts)
Karl Albiker
1919-45 Professor an der Akademie der bildenden Künste in Dresden.
Karl Albiker vertrat die damals vorherrschende akademische Kunstauffassung:
eine Klassik, die es zu kopieren galt - das Zeichnen vor der Natur,
die zeitlose Statik und Harmonie der Gestalten. Zumindest für den
Lernenden gab es einen anderen Weg zur Kunst. Albiker hatte in Paris
studiert, dort Rodin kennengelernt, den er bewunderte. Dessen Wort,
man müsse ,,nicht nur mit den Augen sehen, sondern mit dem Verstand"
hat ihn stark beeinflusst.
---------------------------------------------------------------------------------------
|
|

Luftgaukommando, Aufnahme 1939 
Blick in die Anlage

Bauplastik von Karl Albiker,
Foto: TK 2023,
Vergrößerung - Vorbereitung zum Krieg !

Karl Albiker "Fliegender Genius" - Reliefplastik, Foto: 1939 
Haupteinang mit Albiker-Relief 
"Block G" 
Blick auf die Hauptachse 
Fenstergewände und Bauplastik 
Freitreppe zum Eingang + Steinobelisk 
Foyer mit Treppenaufgang 
Detail Treppengeländer
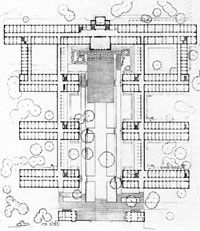
Grundriss Luftgaukommando, Vergrößerung

Landesregierung Sachsen, 1950 - im Gebäudekomplex des ehem. Luftgau-
kommando IV - unten ebd.


Beratung des Sächsischen Landtages 1946, vorn links: Otto Grotewohl,
dann Fritz Große, Felix Kaden
|
|
Aufbau
nach dem Krieg:  Wolfgang
Rauda Wolfgang
Rauda
Die zu etwa 1/4 zerstörte Anlage wurde bereits ab August 1945 von
Prof. Wolfgang Rauda für das neue, kommunistisch gelenkte Sächsische
Scheinparlament der "Einheitsfront" wiederhergestellt. Erstaunlich
ist, daß diese Wiederher-stellung des militärischen NS-Baus
für diesen Zweck bis ins äußere Detail geschah. Der
komplett zerstörte Flügel D wurde mit allen Türrahmungen
und Fenstern aus Muschelkalk ebenso wie eine Nachbildung des Reliefkopfes
von Otto Lilienthal rekonstruiert.
Prof. Rauda ist wenig später 1946 im Zuge des Entnazifizierungsgesetzes
aus der Dresdner Bauverwaltung entlassen worden und 1958 von der DDR
in die Bundesrepublik übergesiedelt. Bereits 1957 beteiligte er
sich an einem Wettbewerb zur Kölner Dom-Umgebung.
Das erste Sächsische Nachkriegsparlament wird am 20.10.1946 mit
großer Manipulation seitens der SMAD (Sowjetische Militäradministration)
gewählt. Die SED gewinnt mit 49 % und stellt den Ministerpräsidenten
Dr. Rudolf Friedrichs (ehem. SPD). 24,7 % erringt die LDP, 23,3 % die
CDU. Nach Friedrichs Tod 1947 übernimmt bis zur Auflösung
der Länder in der DDR Max Seydewitz.
Literatur
Heidrun Laudel: Das Luftgaukommando Dresden. Umgang mit einem Militärbau
aus der NS-Zeit. In: Architektur und Städtebau der 30er/40er Jahre.
Ergebnisse der Fachtagung in München 1993.
Hermann Rahne, Zur Geschichte der Dresdner Garnison im Zweiten Weltkrieg
1939 bis 1945. In: Verbrannt bis zur Unkenntlichkeit, Altenburg 1994.
Matthias Donath: Architektur in Berlin 1933 - 1945, Berlin 2004. (Zum
Luftgaukommando III in Dahlem von Fritz Fuß 1936 bis 38, S.148-151.
Der Architekt F. Fuß war ein Schüler von Wilhelm Kreis. Die
Berliner Anlage erinnert stark an diejenige in Dresden.)
Joachim Petsch: Kunst im Dritten Reich. Architektur, Plastik, Malerei,
Alltagsästhetik, Köln 1994.
Mortimer
G. Davidson, Kunst in Deutschland 1933 - 1945, Bd 3/1 - Architektur,
Tübingen 1995.
Werner Durth, Deutsche Architekten, Stuttgart 2001
(Buch über Aufstieg und Ausbildung junger Architekten in Zeiten des
Nationalsozialismus)
Winfried Nerdinger, Architektur, Macht, Erinnerung. Stellungnahme 1984
bis 2004, Hrsg. v. Christoph Hölz, Regina Prinz, Berlin/ München
2004 |
|

Volksbegehren
vom 23. 05. bis 13.06.1948 / Kundgebung vor dem Sitz des damaligen Sächsischen
Landtages, dem früheren Luftgaukommando IV.

Auf dem Propagandaspruch steht: "Idee wird materielle Gewalt, wenn
sie die Massen ergreift."
Am 6.12.1947 fand in Berlin der sogenannte „Deutsche Volkskongress für
Einheit und gerechten Frieden“ statt. Dieser SED-gesteuerte "Volkskongress"
forderte von den Besatzungsmächten die Bildung einer neutralen gesamtdeutschen
Regierung und den Abschluss eines Friedensvertrages. Während die Sowjetunion
dem aus geopolitisch-strategischen Gründen zustimmte, lehnten die
Westmächte beide Forderungen ab.
Das dann vom 23.5. bis 13.6.1948 in der SBZ und in der britischen Zone
durchgeführte Volksbegehren unterzeichneten 38% aller Wahlberechtigten
von ganz Deutschland. In der amerikanischen und französischen Zone wurde
dieses Volksbegehren verboten. Die Abstimmung blieb ohne Folgen.
Nur eine Woche nach Ende des Volksbegehrens wurde am 20.6.1948 in den
Westzonen eine separate Währungsreform durchgeführt, die auch auf Westberlin
ausgedehnt wurde, was wiederum die "Berlin-Blockade" auslöste
... |



 am
am