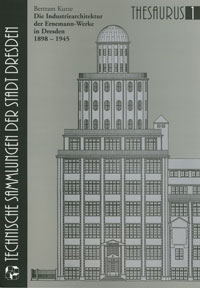|
| Architekt:
|
|
Emil
Högg und Bauingenieur Richard Müller |
| Bauzeit: |
|
1915- 18, 1922- 23 |
| Adresse:.
|
|
Junghansstraße
1
|
Webseite
der außerordentlich sehenswerten Technischen Sammlungen Dresden:
______www.tsd.de
"Die H. Ernemann
AG erwarb 1913 ein Grundstück neben ihrem Stammhaus und ließ
einen vierflügeligen Bau für die Kameraproduktion projektieren.
Ein Hofgebäude sollte Kraftzentrale, Gießereien und Kantine
aufnehmen. Nur der 6-geschossige Trakt (1915-18) und das 12 geschossige
Turmhaus sowie der Flügel an der Schandauer Straße (je
1922-23) entstanden planmäßig. Ein Flügel an der Glashütter
Straße wurde vereinfacht ausgeführt. Bei der Gestaltung
in Eisenbeton-Skelettbauweise errichteten Komplexes wurde auf historisierende
Elemente und eine Verkleidung des Betons verzichtet. Die vor die Wandfläche
gezogenen Stützen wurde mit Perlstäben ornamentiert und
verleihen dem Gebäude eine vertikale Dynamik, die erst durch
die zurückgestuften Dachgeschosse abgefangen wird.
Das Turmhaus sollte repräsentative Büroräume und eine
Sternwarte aufnehmen."
(Architekturführer Dresden 1997)
Bekenntnis zur Großstadt
Am auffälligsten ist wohl die originäre Turmlösung.
Selbstbewußt ragt aus der gestaffelten Ecke des
Gebäudekomplexes ein mehrstöckiger ovaler Turm heraus und
verleiht diesem Teil Striesens dadurch ein markantes großstädtisches
Gepräge. Seinerzeit sollte der eigenwillige Turm sogar Assoziationen
zu US-amerikanischen Wolkenkratzern wecken, wie Bertram Kurze in "Die
Industriearchitektur der Ernemann-Werke in Dresden 1898 - 1945"
darlegt. Der Autor beschreibt u.a. darinnen den Wettbewerb zu diesem
Vorzeigewerk, an dem auch Riemerschmidt
1912- 14 teilgenommen hatte. Die Entwürfe zu dem Erweiterungsbau
sollten weder nur mit "nüchterner Zweckmäßigkeit"
noch im "Bausyle vergangener Jahrhunderte" ausgestattet
sein. Der Bauherr entschied sich jedoch für Högg & Müller,
wohl gerade wegen des imposanten Turmes, welcher an amerikanische
Geschäftshäuser erinnerte. War es doch die "Propaganda",
auf die Ernemann nicht verzichten wollte,
"... um so weniger, als uns hierin andere Länder,
z.B. Amerika, mit denen wir den Wettbewerb auf dem Weltmarkte zu führen
haben, weit voraus sind. Michel kann artig und still sein, wenn John
Bull und andere Rivalen brüllen ... "
(Textquelle zitiert nach: Bertram Kurze: Die Industriearchitektur
der Ernemann- Werke in Dresden 1898-1945,
hrsg. von den Technischen Sammlungen Dresdens 1998)
"Besonders das innere Konstruktionsprinzip der Fabrik war als
technische Meisterleistung anzusehen: Mit Hilfe versetzt angeordneter
Säulen erlangte Ingenieur Müller zum einen die großzügigen,
wenig unterbrochenen Innenräume, zum anderen konnten resonatorische
Schwingungen des Stahlbetongerüstes nahezu ausgeschlossen werden.
Alle Fenster sind in das Raster des Stahlbetonskeletts so eingefügt,
daß für die Innenräume eine hohe Lichtausbeute erreicht
wurde. (aus: Tilo Richter, Industriearchitektur in
Dresden, 1997)
"Auf historisierende Elemente verzichtet"?
Ein imposanter Turm, aber ein konventionell geschmückter Eingang?
Dem oberen Zitat aus dem Architekturführer von 1997 muss widersprochen
werden. Gerade der repräsentative Haupteingang ist ein ganz typisches
Beispiel für die anhaltende Wirkung traditioneller Einflüsse.
Das Portal ist aufwändig mit mehreren klassischen Gestaltungselementen
gegliedert, so ein hervorgerückter Dreiecksgiebel, Pilaster,
eine Treppe und vor allem eine reich in goldener Ornamentierung gestaltete
Tür, welche darüber ein Oberlicht mit verschieden farbigen
Glasmosaiken erhielt.
Auch außerhalb der Portalzone finden sich jede Menge in der
Bautradition wurzelnde Elemente, wie die direkt in den Stampfbeton
ornamentierten Perlstäbe, die ovale Form der Fenster im oberen
Turmbereich, die kupferbedeckte Kuppellösung, Unterteilung der
Fenster in Sprossen, Gesimse, Symmetrie, Profilierungen u.v.m.
Natürlich ist dieses Werk ein klarer moderner Fabrikbau im Stil
der sehr frühen "Neuen Sachlichkeit", welcher auf geometrische
Grundformen aufbaut. Aber er ist zugleich auch ein Bau, der eine Balance
zwischen Aufbruch und Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Bautradition
wahrt. Emil Höggs und Richard Müller's Ernemannwerk zeigen
gerade, wie neue Baustoffe und die Vereinfachung der Formen mit der
geschichtlich gewachsenen Kontinuität versöhnt werden sollten.
Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer beschreibt den Bau so: "Die trotz
der funktionsbedingt großen Fensterflächen strenge Fassadengliederung
der feinmechanisch-optischen Fabrik könnte man als Neoklassizismus
mit nachklingenden historischen Elementen charakterisieren." (Skizze
einer Geschichte der modernen Architektur in Dresden von der Jahrhundertwende
bis in die 30er Jahre, in: Festschrift Professor Jürgen Paul, Dresden
2000)
Für die Fassade und die architektonischen Strukturen war übrigens
E. Högg verantwortlich, während Müller das später
patentierte Tragwerk konzipierte. Details über die Theorien des
TH-Professor Högg zum Verhältnis Architektur - Ornament
siehe auch: Emil Högg, Das Ornament oder Schmuckwerk, Strelitz
(Mecklenburg) 1925.
Public Relation im Stadtraum
Seit 1992 nutzen die Technischen Sammlungen der Stadt das leerstehende
Firmengebäude eines der innovativsten sächsischen
Unternehmen. Damit ging
nach über 100 Jahren Firmengeschichte dieses traditionsreiche,
international geachtete Werk für Spiegelreflexkameras und optische
Geräte zu Ende - wie Tausende andere zu VEB's umfunktionierte,
verstaatlichte Betriebe in Sachsen nach 1989.
Nur noch der markant in der Straßenfront herausragende Turm
erinnert an das damalige Konzept, durch vertikale Betonung der Firmengebäude
Werbung in eigener Sache zu betreiben. Heinrich Ernemann hatte ausdrücklich
eine ausdrucksstarke Architektur, die Reklame für seine Weltfirma
machen soll, gefordert:
""Man mag z.B. über die Orientalische Zigarettenfabrik
Yenidze vom künstlerischen Standpunkte aus urteilen wie man will;
vom geschäftlichen Standpunkte ersetzt sie der Firma alljährlich
mindestens 20 000 Mark für Reklame in anderer Form, wie Annoncen,
etc. Die originelle Form allein verzinst so ein Kapital von ca 1/2
Million Mark. ... Bei allem Idealismus lassen sich Propaganda und
Aesthetik nicht immer vereinigen."
(Bauprogramm mit Anmerkung des Bauherrn, 1913, in: Germ. National
Museum Nürnberg), Nachlaß. /
(Textquelle zitiert nach: Bertram Kurze: Die Industriearchitektur
der Ernemann- Werke in Dresden 1898-1945,
hrsg. von den Technischen Sammlungen Dresdens 1998)
Turmhaus - Hochhaus
Das Ernemannwerk kann man als eines der ersten Hochhäuser Dresdens bezeichnen. Geschickt wurden die fünf oval aufragenden Büroetagen (einschließlich geplanter Sternwarte) als Turm bzw. Turmhaus bezeichnet, um darüber hinweg zu täuschen, dass es sich im Grunde tatsächlich um ein Hochhaus handelte. Ähnliche Ausnahmen wurden bei der Baugenehmigung für den Industriekomplex der Zigarettenfabrik Yenidze (gebaut 1908-09) gemacht, die auch weit über der normalen Dresdner Firsthöhe von 22 m aufragte. Aber bei Industriebauten wurde ein anderer Maßstab angelegt, als bei Geschäfts- und Wohnhäusern. So konnte dann doch der Ernemann-Turm insgesamt 48 Meter (!) in die Höhe gehen.
Die
Architekten
Emil Högg und Richard Müller
Das Architektenduo schuf u.a. in Dresden gemeinsam zur
6.
Jahresschau der Deutschen Arbeit 1927 auf dem alten Ausstellungsgelände
Stübelplatz mehrere Gebäude.
Prof. Emil Högg (1867-1954)
Der heute wenig bekannte Architekt Prof. Dr. Ing. e.h. Högg war bis 1904 als Stadtbaumeister unter Stadtbaurat Ludwig Hoffmann in Berlin tätig. Ein Jahr später gründete er dann in Bremen das Gewerbemuseum sowie Gewerbeschule und wurde dort Direktor (siehe Bild einer modernen Straßen-leuchte rechts). 1911 bis 1933 hatte er den Lehrstuhl für Raumkunst und Ingenieur-Baukunst an der TH Dresden inne. Bekannt wurde er durch seine Veröffentlichungen zur Gestaltung von Friedhöfen und Denkmalen, durch seine Tätigkeit als Beauftragter für Soldatenfriedhöfe in Belgien 1914 bis 1918 sowie als Kirchenbauwart und Denkmalpfleger.
1928 bis 1931 baute er das klinkerverblendete
Pumpspeicherwerk in Dresden-Niederwartha. Auch Emil Högg ließ sich verleiten, mehrfach zur NS- Weltanschauung des Dritten Reichs bejahende Positionen einzunehmen.
Infos zu Emil Högg: http://de.wikipedia.org
Wiederherstellung des Alten
An dieser Stelle sei kurz erwähnt, daß die 20er und 30er
Jahre in Dresden nicht nur eine Zeit des Öffnens für
neue architektonische
Ideen waren, sondern auch eine verantwortungsvolle Zeit der Bewahrung
des Überlieferten. Viele historische Gebäude waren stark
renovierbedürftig geworden. Die Stadt Dresden besann sich dieser
für die Industrie- und Kulturstadt so anziehenden Bauten und
steckte Tausende von Reichsmark in deren Instandsetzung (u.a. auf
Druck des Sächsischen Heimatvereins). Damit investierte die weitsichtige
Stadtverwaltung auch in die Zukunft des Tourismusstandortes Dresden.
Das Palais Wackerbarth, die Ritterakademie in der Neustadt und das
Cosel-Palais wurden im Inneren wie im Äußeren wiederhergestellt.
Bedeutende Restaurierungsarbeiten setzten 1925 im Inneren der Frauenkirche
ein. Von 1938 - 44 gelang es in einer 2. umfassenden Sanierungsphase
durch statische Maßnahmen (u.a. Einziehen eines Kuppelringes),
die Frauenkirche in ihrem Bestand wieder zu sichern. Die fortschreitende
Zerstörung des Zwingers konnte Hubert Ermisch ab 1924 durch eine
Generalrestaurierung beenden.
Diese Maßnahmen der Denkmal- und Stadtbildpflege bildeten ein
wichtiges Gegengewicht zum großen Modernisierungs- schub in
Deutschland, den das Industrieland Sachsen und seine Hauptstadt Dresden
mit voran trieb.
Heimat und Globalisierung
Bemerkenswert ist auch, daß ausgerechnet in Dresden (bereits
1904) ein Deutscher Bund Heimatschutz ins Leben gerufen wurde,
der aufgrund fortschreitender Industrialisierung und Auflösung
traditioneller Bezugsquellen rasch deutschlandweit aktiv wurde. Wenig
später gingen aus dieser Institution mehrere neue Vereine hervor,
so u.a. der Naturschutzbund. Leider konnte der Heimatschutzbund nicht
verhindern, daß er ab 1933 von den ultrakonservativen Nationalsozialisten
für ihre Zwecke instrumentalisiert wurde. Die radikalen Ideologen
wußten sehr geschickt deutsche Modernisierungsängste für
ihre Propaganda zu nutzen, die bald in eine totalitäre Diktatur
führen sollte.
Lesetipp:
Kurze, Bertram:
Die Industriearchitektur der Ernemann-Werke in Dresden 1898 - 1945,
hrsg. von den Technischen Sammlungen Dresdens 1998.
Göllner, Peter: Ernemann Cameras und die Geschichte des Dresdner Photo-Kino-Werks.
Wittig Fachbuchverlag, 1995 ISBN 978-3930359295 (antiquarisch)
Heckner, Hans: Neubauten der Professoren Dr.-Ing. E. Högg und
Dr. Ing. R. Müller. Dresden ersters Turmhaus. In: Der Industriebau,
XV. Jg. (1924), Heft 1.
www.dresdner-kameras.de
|
|

Portal (Haupteingang)
Detail Eingang 
Ehemaliges Ernemann-Werk in Striesen 
Turm als sichtbare Reklame
im Stadtraum
Eckbetonung und ovale Turmspitze 
Ernemannwerk 1949 
Das Firmenlogo
im Eingangsbereich stellt
ein Malteserkreuz zum Transport der perforierten Filmrolle in herkömmlichen
(nicht digitalen) Filmprojektoren dar.
 
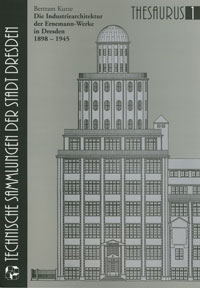
Bertram Kurze: Die Industriearchitektur der Ernemann-Werke in Dresden 1898 - 1945,
hrsg. von den Technischen Sammlungen Dresdens 1998.
 
11 m hoher Jugendstilmast
in Berlin Pankow- 1909 vom damaligen Bremer Architekten Emil Högg entworfen,
2003 restauriert.

Pumpspeicherwerk
Niederwartha - von Emil Högg, Foto: TK 2018
|