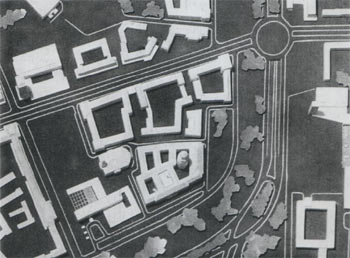|
|
Architekten: |
|
VEB
Hochbauprojektierung
Heinz Mersiowsky, Gerhard Hermsdorf |
Wohnbebauung Ringstr. /
Wilsdruffer Straße: |
|
Herbert
Schneider (Städtebau)
Herbert Terpitz, Heinz Mersiowsky,
Manfred Arlt (Hochbau) |
|
Bauzeit: |
|
1959- 61 |
|
Adresse: |
|
Wilsdruffer Straße 3
ehem. Ernst-Thälmann-Straße |
Das Hochhaus ist Teil des Blocks B/D Süd zw. Wilsdruffer Straße, Ringstraße und Fußgängerbereich an der Gewandhausstraße.
Nach
dem Tod Stalins 1953 wendete sich die DDR-Ästhetik allmählich
vom volksbezogenen Arbeiterklassenpathos zur neuen Sachlichkeit -
mit deutlich weniger Ausschmückung und Zierat. Dabei wurde in
Dresden die Förderung der traditionell starken (verstaatlichten)
Handwerksbetriebe zugunsten des industrialisierten Bauens der VEB's
fallen gelassen. In der Architektur der neuen Bezirksstadt spielte
dann eine thematisierte Festkultur
kaum noch eine Rolle, stattdessen Pragmatismus und - eine schrittweise
Annäherung an die vorherrschende westliche Kultur bzw.
internationale Kultur (einschließlich blockfreie Länder).
Das diktierte
Studium des deutschen Kulturerbes trat mehr und mehr in den Hintergrund.
Ein weiterer wichtiger Grund für die Richtungsänderung bestand aber vor allem in den fehlenden finanziellen Ressourcen. Es konnten schlicht nicht diese Summen aufgebracht werden, die eine aufwändige handwerkliche und schmuckreiche Ausgestaltung erforderte.
Es gab nicht mehr so viel kulturelle Reglementierung von Moskau (Chruschtschow).
Dennoch
wurden immer noch traditionelle Elemente in dieser Übergangszeit
in den Entwurf mit einbezogen, beim Eckhaus Pirnaischen Platz waren
das: ein schräges Ziegeldach und die Verwendung des heimat-lichen
Baumaterials Sandstein.
Was verstand man unter "sozialistische Stadt"?
Das 8-stöckige Haus fällt angenehm durch Ruhe, Klarheit
und eine gewisse bescheidene Unaufgeregtheit auf. Trotzdem ist dieser
Eckbau im Stadtraum von einer klaren Prägnanz. Allerdings - auch
von einer gewissen Nüchternheit, die die vorherige Phase der
prachtvollen Ausgestaltung von Platz- und Straßenräumen
entgegenstand. Gerade jedoch jene unprätentiöse Bauhaltung,
ohne jede rhetorische Geste und Zurschaustellung macht auch den Charme
des Gebäudes aus.
Der Bau mit einer rechteckigen Grundfläche ragt als stadträumliche
Betonung der politisch motivierten Demonstrationsachse (Ernst- Thälmann-
Straße) aus den angrenzenden 6-stöckigen Wohnhäusern
heraus. Er ist als Dominante quasi ein Gegenstück zum "Haus
Altmarkt".
Als Ausnahme wurde hier ein (kleines) Hochhaus
innerhalb des inneren Altstadtbereiches in einer moderaten Höhe
erlaubt, während am Altmarkt 1959 immer noch neue Planungen für ein
riesiges Kulturhochhaus liefen.
Der Hochbau wurde nicht als individuelles Gebäude errichtet,
sondern als Teil eines ganzen Ensembles in östlicher Fortführung
der begonnenen Altmarktbebauung zwischen Gewandhaus-, Weiße
Gasse, Kreuz- und Ringstraße.
Dennoch verleiht das Bürohaus dem Pirnaischen Platz eine kräftige
Akzentuierung und fiele sicher mehr ins öffentliche Blickfeld,
wäre die östliche Straßenkreuzung nicht so eine entsetzlich
weite undefinierte Fläche, die ein Fußgänger (und
durchschnittlicher Konsument) eher meidet. Aber die Stadt ist hier
nicht zu Ende, sondern geht über der Verkehrs-barriere in der
Pirnaischen Vorstadt weiter.
Auf der Rückseite des Bürogebäudes befindet sich ein
größerer begrünter Innenhof mit Kinderspielplatz (!)
, der Teil der gesamten Anlage des Aufbaus vom Dresdner Stadtzentrums
ist (Skizze siehe unten). Die ehemalige dichte Blockinnenbebauung
des historischen Quartiers wurde zugunsten des populären Licht-Luft-Sonne
Prinzips nicht wieder hergestellt.

Kinderrutsche auf dem Rüssel eines Betonelefanten
im Innenhof zw. Weiße und Gewandhausgasse. Gestaltet vom Dresdner
Künstler Friedrich Kracht ca. 1964 (Foto: TK 2006)
Gelungener Übergang zwischen Kontinuität und Reform
"Die Bebauung des Komplexes mußte in ihrer Baukörper-
bildung
und im architektonischen Ausdruck an die Bebauung des Altmarktes anklingen,
um die Einheitlichkeit der Bebauung im zentralen Bezirk nicht mit
diesen Bauten gleicher Zweckbestimmung zu durchbrechen. (...) Es wurde
versucht, die sich allerorts immer mehr durchsetzenden Erkenntnisse
einer starken Vereinfachung aufzunehmen. Ist dieses Eingliedern und
sich Bescheiden gelungen, so wird dies dem Gesamtbild des neuen Dresdens
von morgen nur förderlich sein. (warb Architekt
H. Terpitz um Verständnis, in: "Aufbau der E.-Thälmann-Straße"
1960)
Das ganze Ensemble ist ein erhellendes Beispiel über die Architektudebatten
der frühen DDR bzw. der innerdeutschen Auseinandersetzung vor
dem Mauerbau. Es veranschaulicht die bewegliche Wandelfähigkeit
eines vermeintlich starren Systems, die lebendige Auseinandersetzung
innerhalb der DDR-Gesellschaft und eine sensible Ausbalancierung zwischen
Kontinuitätswünschen und Reformbestrebung.
Aufbau
Die Außenfassade zeichnet sich durch eine individuelle architektonische
Ausgestaltung aus und stört nicht durch Verflachung mit vorgefertigten
Typenelementen. Das Vor- und Zurückspringen der Fenster läßt
eine lebendige Licht-und Schattenwirkung entstehen.
In den unteren zwei Etagen wurden großzügige Verkaufsräume
geschaffen (ehemals Sportartikel), die mit einer elegant geschwungenen
Treppe verbunden sind (derzeit völlig verstellt). Darüber
sind 6 Büroetagen angeordnet, bei der die letzte Etage zurückgesetzt
und ganz in Glas gehalten wurde. Ein Säulengang setzt im oberen
Bereich gestalterisch Akzente.
Die Fassade weist eine klare Rasterung auf, wobei optisch jeweils
zwei Fenster zusammengefasst werden und dadurch keine sterotype Langweile
aufkommt. Dafür sorgen auch rostrote Keramikplatten unterhalb der Fenster. Tatsächlich wurden damals "logistische und finanzielle Anstrengungen unternommen, um den farblichen Kontrast in der Fassadenbekleidung zwischen dem geblichen Wehlener Sandstein für die Betonung des strukturellen Aufbaus und dem rötlichen Cottaer Sandstein für die geschosshohen Eckenfüllungen zu realisieren." (Franz Roland Siegel)
Sanierung 2015-16
Das Haus stand einige Jahre leer. Lediglich Künstler nutzten
zeitweilig die 7. Etage für Ausstellungen und Kino ("useful
information").
2014 kaufte die Firma Hirmer Immobilien das Eckhaus und
wollte damit den gesamten Baublock zwischen Gewandhaus- Kreuz-, Wilsdrufferstraße und Ring
komplettieren. Doch 2015 verkaufte sie an die
Deutsche
Wohnen AG mit Sitz in Frankfurt/Main. Diese Firma sanierte das markante Eckhaus. In den unteren Bereichen
entstanden wieder Ladenflächen, in den oberen Etagen Büros. Mit dieser überfälligen Sanierung wird endlich eine Stärkung der wichtigsten Ost-West-Querung der Innenstadt vorgenommen.
Doch das Innere des Hauses veränderte sich stark. Wesentliche
Bereiche,
Innenstrukturen wurden verändert und neuen Bürobedürfnissen angepasst. 7,4 Millionen Euro hatte Hirmer
für das Projektvolumen veranschlagt.

Foto 2006, TK "Wild / Geflügel" in der Gewandhausstraße kurz nach Schließung des Geschäftes
Literatur:
DDR-Bauzeitung "Deutsche Architektur" 4/1960
"Aufbau der Ernst- Thälmann-Straße in Dresden"
In diesem Artikel wird umfassend über dieses interessante innerstädtische
Aufbauprojekt berichtet, auch über die Konstroversen, die dieses
Ensemble auslöste: wie z.B. die Kritik am "bürgerlich-romantischen
Städtebau" der Weißen Gasse, die mangelnde Berücksichtigung
der "Macht der Arbeiterklasse" durch uneinheitliche, "individualistische"
Architektur im "Fahrwasser funktionalistischer Theorien",
willkürliche, zufällige Gestaltung nicht im rechten Winkel
stehender Bauten, mangelnde Ordnung und Übersichtlichkeit etc.
Toni Salomon: Bauen nach Stalin. Architektur und Städtebau
der DDR im Prozess der Entstalinisierung 1954- 1960, Berlin/ Tübingen
2016
Architekten des gesamten Baukomplexes
zwischen Wilsdruffer Straße, Kreuzstraße, Weiße
Gasse, Gewandhausgasse und Ringstraße:
VEB Hochbauprojektierung Dresden
Entwurfsgruppe II - Block A, B, D:
Herbert Terpitz, Heinz Mersiowsky
Mitarbeit: Manfred Arlt, Tilo Jendrossek, Lorena Johne, Kurt Rößler,
Horst Linge
Entwurfsgruppe I - Block C
Wolfgang Hänsch, Gerd Dettmar
Mitarbeit: Gerhard Hölzel
|
|
 
        
Schöne geschwungene
Treppe zur ersten Verkaufsetage

Ernst-Thälmann-Straße mit Einmündung zur Gewandhausstraße, Postkarte 1963, Vergrößerung


Blick vom Hochhaus auf das Ring-Quartier, Dez. 2004, Vergrößerung


Max Lachnit: 1958–1959 Goldener Löwe - Werbeplastik für die Löwenapotheke und zugleich bauplastische Kunst, Vergrößerung, Foto: TK 2012


Trümmerbruchstücke ehemaliger Barockhäuser wurden als Spolien in die Gebäudemauern der Neubauten integriert. Hier z.B. Putten vom Böttchererker (Frauenstraße 14), Foto: 2006
|
|
Architekt Herbert Terpitz _1903 - 1967
Zwei Jahre nach Beendigung der Blöcke an der Wilsdruffer- / Ringstraße wurde Herbert Terpitz mit einem Bauprojekt betraut, dass nur wenige Meter weiter südlich der "Magistrale" lag. Gemeinsam mit Manfred Arlt war er 1962-65 verantwortlich für den Wiederaufbau des Rathaus-Ostflügels mit einer modernen Interpretation des Festsaals und einer neuen Außenfassade, die sich den Proportionen der gründerzeitlichen Fensteröffnungen zeitgenössisch näherte, den Historismus lediglich in reduzierter Form des Bestandes einsetzte. Im Vergleich zur steinern-schweren Südfassade, die bereits 1951 vollendet war, kommt die neue Ostfassade leicht und in einem ausgewogenen Verhältnis von Glas-Stein daher.
Man darf an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass Herbert Terpitz in Dresden auch schon in der NS-Zeit arbeitete. Beim ursprünglichen Wettbewerb zum geplanten Gauforum 1934/35, nur wenige hundert Meter weiter östlich vom Rathaus, gewann er mit Müller-Moreitz (Leipzig) sogar den ersten Preis. Sie wurden aber disqualifiziert, weil Terpitz zu dieser Zeit kein Mitglied in der Reichskammer der Bildenden Künste war. (siehe C.Wolf, Gauforen. Zentren der Macht)
Gelernt hatte Terpitz an der Staatsbauschule Hochbau und Tiefamt Dresden mit einem Abschluss 1925. Ein Studium an der Dresdner Akademie von 1929-33 bei Kreis schloss sich an. 1938-40 Lehrerstelle für Baukunst an der Kunstgewerbe-
schule Dresden. 1940-45 offiziell Lehrer für Baukunst an der Kunstakademie, defacto jedoch Einberufung als Hilfspolizist (Wachtmeister) im besetzten Polen (Krakau).
1951 - Mitarbeiter Industrie-Projektierung Dresden I
1957 - Tätigkeit beim Entwurfsbüro für Hochbau Dresden I
mehr Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Terpitz
|
|
|